In der Serie “Netzwert Reloaded” verfolge ich jeden Montag, was das Team von Handelsblatt Netzwert vor exakt 10 Jahren über das digitale Geschäft schrieb. Alle Netzwert-Reloaded Folgen finden Sie hier.

Bei Netzwert taten wir uns mit der Benennung jener Geräte immer schwer. Denn Anglizismen standen damals auf dem Index und die klare Weisung der Chefredaktion war es, zu viele Schwirrworte zu vermeiden – und sie außerdem am Rand zu erklären. In der Ausgabe vom 5.11.2001 war somit neben einer Geschichte zu lesen: „Handhelds sind Handteller große Computer, meist ohne Tastatur. Der Name des ersten Herstellers Palm ist inzwischen Synonym für die gesamte Produktkategorie, ähnlich wie einst der Walkman.“ Meistens schrieben wie also „Handteller-Computer“ oder etwas ähnliches.
Der Artikel jedoch zeigte einen Blick in die Zukunft. Die US-Armee nämlich experimentierte bereits intensiv mit Handhelds, sie gehörte zu den ersten Palm-Großkunden. Einerseits nutzte sie die Geräte zur Lagerverwaltung und Logistiksteuerung. Andererseits hoben die Handhelds die Stimmung an Bord manches Kriegsschiffes. Denn dort waren oft nur wenige PC mit Online-Zugang zu finden. Seeleute, die eine E-Mail an die Heimat senden wollten, mussten oft in langer Schlage warten. Wer dagegen über einen Palm verfügte – und das galt anscheinend auch für private Geräte – konnte sie an die Schiffs-Mail koppeln und so unabhängig senden. Ein Navy-Sprecher nannte dies „eine Moral-Rakete“.
Doch genauso waren Palms bereits im Kriegseinsatz: als Kartenspeicher, Wissensdatenbank und als Truppen-Lenk-Instrument. Auch Waffensysteme konnten so schon gesteuert werden. Und dabei war das Investment nicht einmal so hoch, wie man denken könnte: Die einfachsten Handteller-Computer kosteten 150 Dollar, eigens produzierte Top-Geräte nicht mehr als 1500 Dollar.
Eine der Netzwert-Geschichten, die mir in all den Jahren immer im Kopf geblieben ist, handelte von einem Tankstellen-Service-Unternehmen namens Union Technik. Wer heute die Homepage der Duisburger besucht, bekommt den Hinweis, diese befinde sich „in der Entwicklung“. Kaum zu glauben, dass Union damals eine Außendienststeuerung besaß, die ein Musterbeispiel für die Anwendung vorhandener Techniken für neue Zwecke war.
Union verfügte über eine Datenbank mit sämtlichen technischen Gerätschaften aller betreuten Tankstellen. Meldete eine von ihnen ein Problem konnten die Techniker am Telefon häufig schon Hilfe leisten. Muss doch ein Außendienstler anreisen, so wurde der gerufen, der jener Tankstelle am nächsten war. Dies konnte Union per GPS-System ermitteln, über das jeder reisende Mitarbeiter verfügte. Wohlgemerkt: Es geht hier um das Jahr 2001. Die Aufträge an diese Außendienstler wurden automatisch per SMS verschickt, inklusive Art des Störfalls und Adresse des Kunden. Der angenommene Auftrag wurde dann wieder per SMS bestätig, diese Nachricht floss automatisch in das System. Bemerkenswert.
Zum Team von Netzwert zählte ja auch der geschätzte Olaf Storbeck, heute Ökonomie-Experte des „Handelsblatts“ in London und Autor des Blogs Economics Intelligence. Wenn Olaf sich ärgert, dann ärgert er sich richtig. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich seine Kolumne „E-Mail aus Köln“ las, in der es um den Auftritt des US-Autor Thomas Frank ging. Denn so schreibt er auch noch heute, eigentlich ist die Kolumen ein Blog-Artikel. Jener Thomas Frank hatte 2001 ein Buch veröffentlicht, in dem er das Ende der New Economy ausrief – was nun wirklich keine große Überraschung war. Und Olaf fand den Auftritt Franks in Köln… verbesserungsfähig:
„… Peinlich auch, dass unser Kulturkritiker aus Übersee gar nicht genau weiß, was er da kritisiert. So macht er sich ausführlich über die Vorstellung lustig, in der New Economy würden irgendwelche neuen ,Gesetze‘ gelten und ämüsiert sich unter anderem über ,Metcalfes Gesetz‘. Dummerweise fragt ein Zuhörer ganz unverfänglich, was dieses Gesetz denn nun besage. Frank gesteht: ,Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube es hat irgendwas mit dem Internet zu tun.‘
Sowieso, die Fragestunde bringt den Intellektuellen in Verlegenheit: Was denn sein politischer Standpunkt ist, wollen immer mehr Zuhörer wissen. Aber Mr. Frank will sich lieber nicht so genau festlegen: ,ein Linker‘, sei er schon. Aber was bedeutet das genau? ,Ich mag Gewerkschaften und Roosevelt.‘ Weiteren Fragen weicht Frank mit einem Vorschlag aus: ,Lasst uns doch ein Bier trinken.‘ Seine erste wirklich gute Idee an diesem Abend.“
Im Jahr 2011 ist häufig die Rede von Content Farmen. Also von Seiten, die billig Inhalte erschaffen, daneben Werbung platzieren und versuchen bei Google nach oben zu kommen. Zehn Jahre zuvor gab es etwas Ähnliches – allerdings besaßen die Inhalte mehr Qualität. Damals war bei einer steigenden Zahl von Menschen der erste Reflex im Angesicht einer Krankheit der Klick ins Web. Dort tummelten sich gleich mehrere Dienste, die Krankheits-Gesundheits-Inhalte bereit stellten und diese einerseits per Werbung refinanzierten, andererseits durch die Lizenzierung an Homepages von Krankenversicherungen oder Hospitälern. Vor allem drei rangen um den Markt in Deutschland: Netdoktor, Gesundheitsscout24 und Medicine-Worldwide. Letzteres wurde geführt von der damals 29-jährigen Biochemikerin Christine Reuter. Und: Das kleine Startup machte bei 800.000 Mark Umsatz auch noch Gewinn. 2004 wurde dann verkauft: Medicine-Worldwide ging an Onvista. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Unternehmen sechs Mitarbeiter und zählte im Monat 5,8 Millionen Page Impressions.
Tja, und dann war da noch Brigitte Zypries. Tatsächlich war sie damals, als Staatssekretärin im Innenministerium, eine kompetente Ansprechpartnerin in digitalen Fragen. Sie beantwortete den Arbeitsplatz-Fragebogen, der jede Woche auf der letzten Netzwert-Seite zu finden war. Sonderlich unterhaltsam waren ihre Antworten nicht: Sie surfe eine Stunde pro Tag, könne sich ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen, wünschte sich eine Flugbuchungs-Suchmaschine.

Einige Jahre später mussten wir dann feststellen: Das mit dem Dazulernen hat nicht so richtig toll funktioniert.



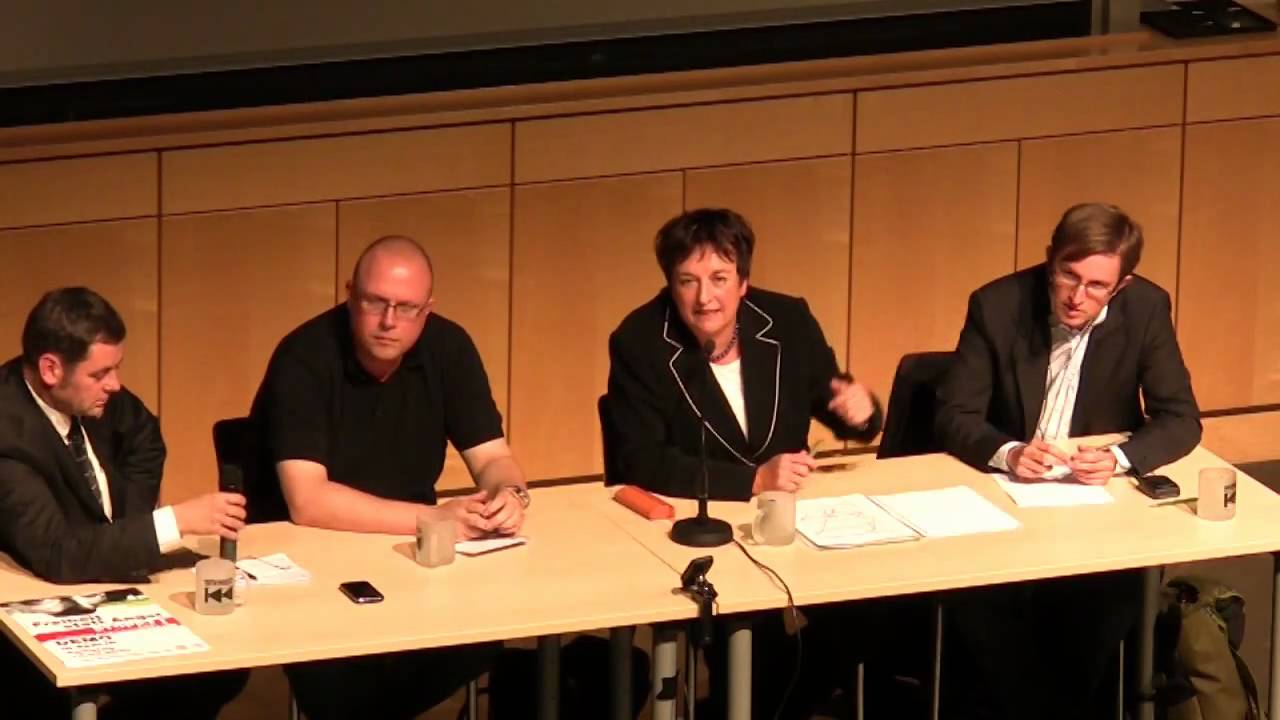


Kommentare
Malte 16. November 2011 um 17:02
Da fällt mir ein: Ob Frau Zypries mittlerweile weiß, was ein Browser ist? 😉